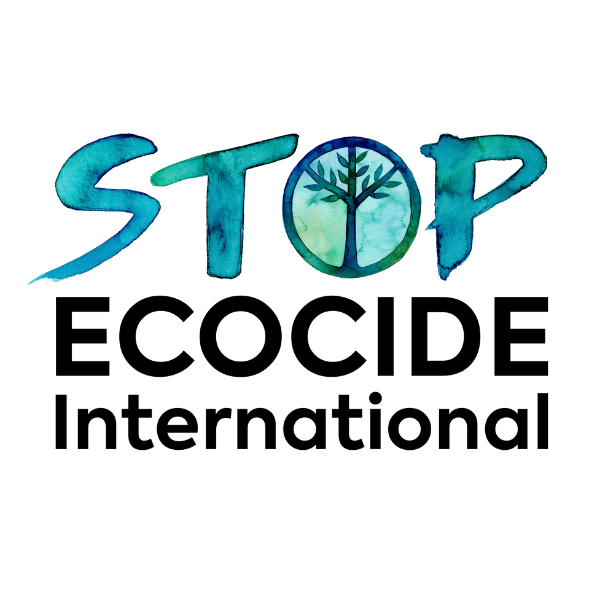Ökozid-Konzept und der Aufschwung ökozentrischer Rechtssysteme
Dieser Gastblog wurde von Paola Vitale verfasst, die an der Universität Bologna Rechtswissenschaften studiert hat und sich nun für Umwelt- und Klimarecht einsetzt.
Oft scheint es, als hätten wir vergessen, wie eng wir mit der Natur verwoben sind - dass wir nur eine Tierart unter vielen sind. Darin spiegelt sich ein langer historischer Trend wider, uns selbst an die Spitze einer Pyramide zu stellen, mit anderen lebenden Arten und Ökosystemen unter uns. Diese Weltanschauung ist als Anthropozentrismus bekannt.
Da das Recht immer das widerspiegelt, was wir als Gesellschaft für wertvoll und schützenswert halten, spiegelt sich unser Versagen bei der Wertschätzung der natürlichen Welt auch in unserem internationalen Rechtssystem wider. Die anthropozentrischen Ursprünge des Rechts zu verstehen, ist wichtig, um seinen anhaltenden Einfluss auf unser Rechtssystem zu bewerten und einen Weg zu finden, ein ökozentrischeres Rechtssystem zu schaffen. Erfreulicherweise gewinnen ökozentrische Rechtssysteme zunehmend an Bedeutung.
Die Allgegenwärtigkeit des Anthropozentrismus
Entlaubungsflug mit vier Flugzeugen, Teil der Operation Ranch Hand. Credit: Wikimedia.
Es zeugt von der Allgegenwärtigkeit des Anthropozentrismus in unserer Gesellschaft, dass selbst unter denjenigen, die sich für den Umweltschutz eingesetzt haben, Elemente dieser hierarchischen Weltsicht zu finden sind. Arthur Galston und die Wissenschaftler, die sich gegen das großflächige Versprühen von Herbiziden in Vietnam im Rahmen der als "Operation Ranch Hand" bekannten Militäroperation wehrten, distanzierten sich beispielsweise bewusst vom Umweltbewusstsein der Mitte des 20. Jahrhunderts, das oft als extrem oder fanatisch¹ wahrgenommen wurde. Wie Galston bemerkte: "Zu sagen, dass etwas natürlich ist, bedeutet nicht, dass es gut ist. Diese beiden [Begriffe] sind nicht gleichwertig.
Für viele Wissenschaftler, die der Operation Ranch Hand kritisch gegenüberstanden, ging es nicht um die Umweltschäden an sich, sondern vielmehr um die Folgen, die die Zerstörung von Land und Vegetation für den Menschen hatte, ohne dass ein wirtschaftlicher oder sozialer Nutzen damit verbunden war. Wie David Zierler betont: "Wenn Ranch Hand eine Operation zur Ressourcengewinnung wäre, wäre es kein Ökozid".²
Die Dominanz des Anthropozentrismus hält im internationalen Recht an (siehe hier, hier, und hier). Ein Beispiel, Artikel 23 der Haager Landkriegsordnung verbietet Handlungen, die "das Eigentum des Feindes zerstören oder beschlagnahmen, es sei denn, dies ist durch die Notwendigkeiten des Krieges zwingend erforderlich". Der Schutz bezieht sich also ausschließlich auf feindliches Eigentum, während nicht beanspruchte Ländereien ungeregelt bleiben. Ähnlich, Artikel 53 der Genfer Konvention den Schutz ausschließlich auf das Eigentum von Privatpersonen oder des Staates, so dass die Besatzungsmacht auf nicht beanspruchtes Land frei handeln kann.
In der Vergangenheit haben die Gesetze zum Schutz der Umwelt diese nicht als Selbstzweck geschützt, sondern sich auf den Schutz des menschlichen Eigentums konzentriert.
Die ökozentrische Verschiebung
Gehen wir näher darauf ein. Grüne Kriminologie definiert die Beziehung zwischen Menschen, der natürlichen Umwelt und nichtmenschlichen Tieren durch drei Haupttheorien: Anthropozentrismus, Biozentrismus und Ökozentrismus. Wie wir gesehen haben, ist der Anthropozentrismus eine menschenzentrierte Perspektive, die auf der wahrgenommenen biologischen, geistigen und moralischen Überlegenheit des Menschen gegenüber anderen Lebewesen beruht. Der Mensch wird als separates Wesen und nicht als integraler Bestandteil des Ökosystems betrachtet, so dass jedes menschliche Bedürfnis oder jeder menschliche Wunsch, wie z. B. territoriale Ausdehnung oder technologischer Fortschritt, vor den Erwägungen des Ökosystems gerechtfertigt wird.
Der Biozentrismus hingegen betrachtet den Menschen nur als "eine andere Spezies", schreibt allen Lebewesen einen eigenen Wert und eine eigene Würde zu und geht über die Vorstellung von der Überlegenheit des Menschen hinaus.
Meiner Meinung nach ist das überzeugendste Konzept jedoch der Ökozentrismus. Diese Theorie postuliert die moralische und wertorientierte Gleichheit zwischen Menschen und nicht-menschlichen Wesen innerhalb von Ökosystemen. Der Mensch wird als verantwortungsbewusster Verwalter angesehen, weil er über einzigartige Fähigkeiten verfügt und im Vergleich zu anderen Arten den gesellschaftlichen Fortschritt ermöglicht hat. Folglich sollten die wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen und die Ausbeutung von Ressourcen diese Schutzfunktion gegenüber der Umwelt widerspiegeln.
Ein Beispiel für ökozentrisches Recht: Der Whanganui River in Neuseeland erhielt 2017 die Rechtspersönlichkeit.
Credit: Newzealand.com.
Trotz der anthropozentrischen Ursprünge der meisten Rechtssysteme ist weltweit ein Paradigmenwechsel hin zum Ökozentrismus zu beobachten, wobei die Rechtsprechung die Umwelt zunehmend als eigenständig schützenswertes Gut anerkennt. Beispiele hierfür sind die Verfassung Ecuadors von 2008 die anerkennt. Rechte der Pachamama (Mutter Erde), Boliviens 2010 Gesetz über die Rechte von Mutter Erdeund Neuseelands 2017 erfolgte Anerkennung des Whanganui-Flusses als lebendige Einheit. Andere, stärker ökozentrisch ausgerichtete Ansätze finden sich in der ENMOD-Konvention und Protokoll I der Genfer Konvention. Diese wichtigen Entscheidungen spiegeln den ideologischen, politischen und wertebasierten Wandel wider, der die Gesetze und Vorschriften beeinflusst. Während die Umwelt in der Vergangenheit den menschlichen Bedürfnissen untergeordnet war, verdient sie heute aufgrund ihres Eigenwerts einen eigenständigen Schutz.
Wie Ökozid-Konzept zu einer ökologischeren Sichtweise beiträgt
Ein weiterer wichtiger ökozentrischer Wandel ist in der Entwicklung des Ökozid-Konzept auf globaler Ebene zu sehen. Die Definition von Ökozid die vom Unabhängigen Expertengremium (IEP) im Jahr 2021 vorgeschlagen wurde, stellt eine bedeutende Verschiebung hin zu einer ökozentrischen Perspektive im internationalen Recht dar. Diese Definition bildete die Grundlage für eine wachsende Zahl von nationalen Gesetzesinitiativen sowie für den Vorschlag für ein fünftes Verbrechen des Ökozids, das von den pazifischen Inselstaaten Vanuatu, Fidschi und Samoa im September 2024 beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht wurde.
Dieser Vorschlag auf der Ebene des Internationalen Strafgerichtshofs ist besonders wichtig angesichts der Einschränkungen der bestehenden Bestimmung des Römischen Statuts zum Umweltschutz, die weitreichende Umweltschäden nur während eines Konflikts und nur insoweit verbietet, als sie im Vergleich zu dem erwarteten militärischen Vorteil nicht übermäßig sind.
Die IEP-Definition unterscheidet sich von den traditionellen Umweltbestimmungen wie Artikel 23 der Haager Landkriegsordnung oder Artikel 53 der Genfer Konvention, die die Umwelt in erster Linie insofern schützen, als ihre Schädigung menschliche Interessen beeinträchtigt. Stattdessen misst diese Definition von Ökozid der Umwelt selbst einen intrinsischen Wert bei.
Indem schwere und weit verbreitete oder schwerwiegende und langfristige Schäden an Ökosystemen als internationales Verbrechen eingestuft werden, unabhängig von der direkten Schädigung des Menschen, erkennt dieser Ansatz die Umwelt als ein eigenständig schützenswertes Gut an. Eine solche Sichtweise stärkt den Rechtsrahmen, indem sie sich mit Schäden befasst, die andernfalls außerhalb der anthropozentrischen Schwellenwerte liegen könnten. Auf diese Weise bietet das Ökozid-Konzept einen umfassenderen und wirksameren Schutz der Umwelt, der den vielfältigen ökologischen Krisen unserer Zeit gerecht werden kann.
1. Zierler, D., Die Erfindung des Ökozids: Agent Orange, Vietnam, and the Scientist Who Changed the Way We Think About the Environment, Athens and London: University of Georgia Press, 2011, S. 18.
2. Zierler, D., Die Erfindung des Ökozids: Agent Orange, Vietnam, and the Scientist Who Changed the Way We Think About the Environment, Athens and London: University of Georgia Press, 2011, S. 18.
REFERENZEN:
Greene, A., "Symposium Exploring the Crime of Ecocide: Rechte der Natur und Ökozid", OpinioJuris, (2020).
Zierler, D., Die Erfindung des Ökozids: Agent Orange, Vietnam, and the Scientist Who Changed the Way We Think About the Environment. Athens and London: University of Georgia Press, 2011, S. 1-245.
Brisman, A., und South, N., "Green Criminology and Environmental Crimes and Harms", Sociology Compass 13 (2019), https://doi.org/10.1111/soc4.12650.
Lawrence, J., und Heller, K.J., "The Limits of Article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute, the First Ecocentric Environmental War Crime", Georgetown International Environmental Law Review (2007), S. 4.
Jaffal, Z.M., et al., "Preventing Environmental Damage During Armed Conflict", BRICS Law Journal 5, no. 2 (2018), S. 4.