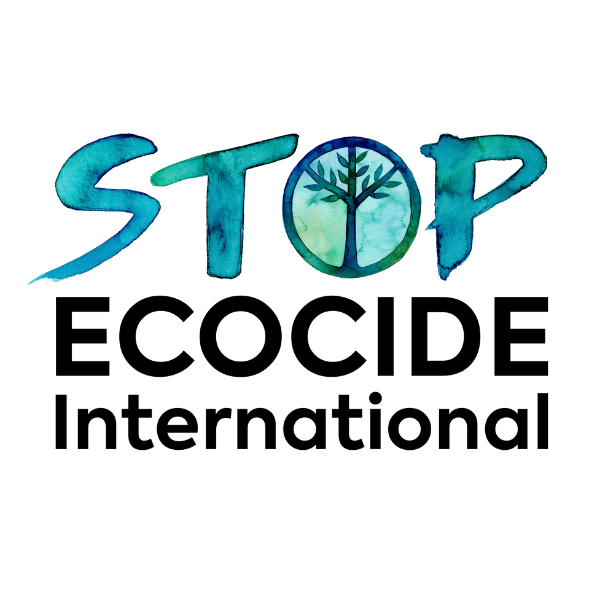Die Perle in Gefahr: Ökozid als Verbrechen in Uganda
Dieser Gast-Blog wird von Ninsiima Louis Kandahura, einer Klimaverfechterin und Geschichtenerzählerin, und Calvin Stewart Obita, einem Menschenrechtsverteidiger, verfasst.
Uganda, oft als "Perle Afrikas" bezeichnet, ist die Heimat üppiger Wälder, fruchtbarer Böden und ausgedehnter Feuchtgebiete. Doch diese Schätze verschwinden in einem alarmierenden Tempo. Die Umweltzerstörung ist nicht mehr nur eine Bedrohung für die Artenvielfalt, sondern eine Krise, die Lebensgrundlagen, Kulturen und Rechte untergräbt. Vor diesem Hintergrund verlangt ein Konzept dringend nach Aufmerksamkeit: Ökozid.
Ökozid im Kontext
Die Idee von Ökozid, der Tötung unserer Ökosysteme, wurde erstmals während des Vietnamkriegs weltweit bekannt, als der Einsatz von Agent Orange Wälder dezimierte und Generationen vergiftete. Rechtswissenschaftler wie Richard Falk und Lynn Berat haben die Idee später erweitert und Ökozid mit der Zerstörung ganzer Arten oder Ökosysteme in Verbindung gebracht. Im Jahr 2021 schlug ein unabhängiges Expertengremium, das von der Stiftung Stop Ökozid einberufen wurde , eine Definition vor: rechtswidrige oder mutwillige Handlungen, die mit dem Wissen begangen werden, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden und entweder weitreichenden oder langfristigen Schädigung der Umwelt besteht.
Obwohl Ökozid noch nicht vom Internationalen Strafgerichtshof anerkannt ist, hat es weltweit an Bedeutung gewonnen. Dreizehn Länder stellen es bereits auf nationaler Ebene unter Strafe, und in der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker ist ein kollektives Recht auf eine zufriedenstellende Umwelt verankert.
Ugandas Rechtslandschaft
Die ugandische Verfassung garantiert in Artikel 39 ausdrücklich das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt. Die Gerichte haben dieses Recht in bahnbrechenden Fällen durchgesetzt. In der Rechtssache Greenwatch gegen Attorney General & NEMA (2002) bestätigte der Oberste Gerichtshof, dass zivilgesellschaftliche Gruppen Umweltschäden auch ohne direkten persönlichen Schaden einklagen können. In ähnlicher Weise betonte das Gericht in der Rechtssache ACODE gegen Attorney General & NEMA (2004) die Pflicht des Staates, Umweltzerstörung zu verhindern.
Doch die Rechtsmittel bleiben weitgehend zivil- oder verwaltungsrechtlich. Sie greifen zu kurz, wenn es sich um eine irreversible Zerstörung handelt, die ganze Feuchtgebiete oder Wälder auslöscht. Zivilrechtlicher Schadenersatz kann ein verschwundenes Ökosystem nicht wiederherstellen. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist das fehlende Element.
Der Fall Tsama William und andere gegen den Generalstaatsanwalt verdeutlicht diese Lücke. Gemeinden in Bududa, die seit langem von tödlichen Erdrutschen geplagt werden, haben den Staat verklagt, weil er es versäumt hat, wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das Urteil des Gerichts steht noch aus, doch der Fall zeigt die Grenzen des derzeitigen ugandischen Rechtsrahmens auf: Vorhersehbare Umweltkatastrophen verwüsten Gemeinden, doch das Gesetz tut sich schwer damit, jemanden wirklich zur Verantwortung zu ziehen.
Giraffe im Murchison Falls National Park, Uganda. Kredit: Ivan Sabayuki/ Unsplash.
Ökozid als Menschenrechtsproblem
Die Verbindung zwischen Ökozid und Menschenrechten ist eindeutig. Die Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker hat diesen Zusammenhang in der Rechtssache SERAC gegen Nigeria deutlich gemacht , in der sie die nigerianische Regierung für das Versäumnis verantwortlich machte, das Volk der Ogoni vor schweren Umweltschäden durch die Ölförderung zu schützen. Die Kommission bekräftigte, dass Umweltrechte untrennbar mit dem Recht auf Leben, Gesundheit und Würde verbunden sind.
Uganda hat ähnliche Verpflichtungen aus Verträgen wie dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Beide Instrumente sind so ausgelegt worden, dass sie den Schutz vor Umweltzerstörung verlangen. Für indigene Völker wie die Batwa, deren kulturelles und physisches Überleben von Waldökosystemen abhängt, kommt die Abholzung der Wälder einer kulturellen Auslöschung gleich.
Warum Uganda das Ökozid-Konzept braucht
Ugandas Verfassung und Gesetze erkennen Umweltrechte an, aber ohne Ökozid bleibt die Durchsetzung schwach. Die Kriminalisierung von Ökozid würde das nationale Recht mit internationalen Menschenrechtsstandards in Einklang bringen und sicherstellen, dass Umweltzerstörung in großem Maßstab tatsächlich zur Rechenschaft gezogen wird.
Ein solches Gesetz würde nicht nur bestrafen, sondern auch abschrecken. Es würde signalisieren, dass schwere, weit verbreitete oder langfristige Schäden an Ugandas Ökosystemen nicht nur ein bedauerliches Nebenprodukt der Entwicklung sind, sondern ein Verbrechen gegen Menschen, Kultur und künftige Generationen.
Schlussfolgerung
Ökozid ist keine ferne juristische Theorie. Es ist gelebte Realität für ugandische Gemeinden, die mit Überschwemmungen, Erdrutschen und ökologischem Zusammenbruch konfrontiert sind. Unsere Gerichte haben das Recht auf eine gesunde Umwelt anerkannt, aber Rechte ohne Durchsetzung sind fragil. Durch die Kriminalisierung von Ökozid würde Uganda seinen verfassungsrechtlichen Versprechen echte Bedeutung verleihen und sich der wachsenden internationalen Bewegung zur Verteidigung der Erde als unserem gemeinsamen Zuhause anschließen.
Die Zeit zum Handeln ist gekommen, bevor die "Perle Afrikas" unwiederbringlich verloren ist.